
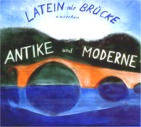

 |
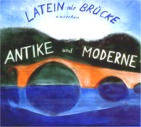 |
 |
Definition MA- Latein:
Anschluß an Spätlatein, Ablösung durch Neulatein =>Betrachtung der Latinität grob zwischen 500 und 1500
Christliches Latein: Christliche Gemeinde: sozial eher
tieferstehende Schichten => Formenstrenge nicht wichtig, Sprache dokumentiert
radikale Erneuerung des menschlichen Lebens; Wille, dem Volk verständlich zu
sein Bibelübersetzungen:
- Vetus Latina = früheste Übersetzungen der griechischen Bibel (ab 2.
Jhd.)
- Hieronymus ( gest. 420 ): Bearbeitung => VULGATA
Lateinische Liturgie: Geformtheit der Rede in
christlichen Bereich gebracht; die Messfeier begleitende Gebete: zunächst
liturgische Improvisation
Seit der Karolingerzeit: Vereinheitlichung nach römischer Liturgie
Deren Kennzeichen: Strenge, getragene Sprache der Gebetstexte,
liturgische Gesänge mit biblischen oder bibelnahen Texten
Belebung der Gottesdienste durch Dichtung besonders an Feiertagen in der
Messe : festlicher Gesang , psalmodierende Poesie => strenge Regeln;
In Spätantike: Chr. Dichter benützen Elemente der heidnischen Epik + Lyrik
=> Modelle , im MA verwendet
Stellung des Latein im MA:
Standes - und Fachsprache des Klerus => Bildungssprache ; Sprache der
europ. Literatur
Mündlich verwendet: daher nur wenig bekannt ( Schriftlatein wesentlicher )
è "Vatersprache" des MA (
zweisprachig , Latein in der Literatur bevorzugt )
Basis: lateinische Hochsprache ( wie sie im 2. Jhd. n. Chr. von
christlichen Autoren verwendet wurde)
Vulgärlatein:
Nie niedergeschrieben (zumindest nicht so wie gesprochen) , da immer
Sprachwissen des Schreibers
Verbindung : Chr. Latein & Vulgärlatein wegen zahlreicher Quellen für Vulgärlatein
im frühen Christentum;
Heute angenommen : " Urromanisch" / " festes Vulgärlatein"
(einheitliche Sprechsprache im ganzen Reichsgebiet ) => Differenzierung (
Beginn : 5. - 7. Jhd. )
Höfisch - ritterliche und Vagantendichtung
Für kleines, gebildetes Publikum ; Vagantendichtung volkstümlicher :
lateinisch , dennoch Kontakt zum Volk (Gesang) ; Vagant von "vagari`` =>
umherziehende Studenten ohne festes Einkommen
Themen : Verherrlichung von Liebe , Wein , Würfelspiel => gegen Ideale von
Kirche & Rittertum
Sprachlandschaften des Lateinischen ( 1. Hälfte des MA ):
Gallien
Frühe Entwicklung einer Volkssprache ; Wiederherstellen der Normen der
lateinischen Hochsprache
Im Hoch - MA : Ausbildung des Altfranzösischen im N und des Altprovenzalischen
im S
Latein der Merowingerzeit : Zerfall / zunehmender Einfluß des Fränkischen und
des Germanischen
Seit Mitte 8. Jhd. : sprachliche Reformen (in Herrscherurkunden dokumentiert )
Unter Karl dem Großen : Einführung der "karolingische Minuskel``=>
Hofschrift des fränkischen Reiches
Italien
Herrschaft der Ostgoten : Blühende Kultur
Ab 568 : Landnahme der Langobarden => Verfall der Bildungseinrichtungen ( bis
700 )
Sprechsprache langsam und wenig von Schriftsprache differenziert ; wenig
gepflegte Sprache
Bezug auf Sprache der chr. Spätantike ; Latein nur mäßig von Langobardischem
geprägt
Iberische Halbinsel
Latein schon lange heimisch ; Fortsetzen bis in frühes MA;
unter den Westgotenkönigen Wiederaufleben der spätantiken Kultur
711: Sieg der Araber über Westg. => Maurenherrsch. => tolerant,
trotzdem Stagnation , Vorrang der arab. Kultur
600-800 : kein großer Unterschied mehr zwischen Latein & Volkssprache im größten
Teil der Halbinsel
Hoch-MA : gepflegte latein. Sprache (11. Jhd.: Aufschwung), volksnahes
Gebrauchslatein, iberoroman. Dialekte
England
43 n. Chr. : röm. Truppen erobern S => romanisiert
Anfang 5. Jhd. : Ansiedeln von Germanen => im S Sachsen ; im N Angeln ; röm.
Kulturreste vernichtet
6. / 7. Jhd. : Missionierung & Christianisierung Latein & Volkssprache
stark getrennt , trotzdem hat das Latein Englands kaum individuelle Züge 1066:
normannische Eroberung => Oberschicht : anglonormannisch => Latein
Vermittler zwischen Angelsächsischem und Anglonormannischem
Irland Weitere Ausdehnung in der 2. Hälfte des MA: Überregionale Funktion des Lateinischen: Stilistisches: Schreibung
Quellenverzeichnis : Langosch , Karl
Außerhalb des röm. Reiches => trotzdem Latein bei der Christianisierung (5.
Jhd.) adaptiert => nur auf kirchl. Lehre und Praxis ausgerichtet ;
Wechselwirkungen Lat. - Volkssprache gering
Irisch: hoch entwickelte Literatursprache => Konkurrenz im geistig -
liter. Bereich
Deutschland
Zumindest zu Beginn : kaum Eigengewicht , da sehr wenig einheitlich
Mitte + 2. Hälfte : v. a. in N und europäischem O - SO ,
Verbreitung des (nach-)karolingischen Lateins ; Volkssprache kaum Einfluß auf
Lat. ; erst spät schriftfähig è Lat. als
anspruchsvolle geistige Kommunikationssprache
Zögernd verbreitetes lat. Schrifttum => oft regionale Bedeutung
Durch karol. Bildungsreform : Gefüge von schriftsprachl. Normen ; im 12.
Jhd. Rückbezug auf klass. Antike è Nachahmung
von: Vergil , Ovid in der metrischen Dichtung / Cicero in der Prosa
einheitlich => versch. Wirkungen : persönl. Stil nach Vorbildern / einförmige
Handhabung der Sprache
Gründe für die Einheitlichkeit: wissenschaftlicher Fachsprache
(scholastische Latinität)
Regionen auch so wechselseitig durchdrungen : Internat. Bettel - &
Ritterorden ,Mobilität d. Einzelnen,intern. Lehrbetrieb => Verbreitung des
jeweiligen Umgangs mit Lat.è Mündlichkeit neuen
Stellenwert , da Zwang zu überregionaler Verständigung => Unterricht auf
lateinisch
Karolingische Bildungsreform : weitgehendes Wiedererreichen des antiken
Lautstandes , trotzdem teilweise keine ausreichende Regelung ( z. B. in der
Verwendung von ae und e )
Morphologie ( Formenlehre )
Lateinische Beugungsmuster gebrochen : Substantive der 4. Dekl. ( u- Dekl. ) oft
wie die der 2. ( o- Dekl. ); oft innerhalb einer Dekl. Kasusformen vertauscht;
auch bei Verben Vermischung der Konjugationen
Syntax
Eventuelle spätantike Zweitformen nun stark verbreitet ( mehr als klass. Formen
); keine feine Unterscheidung der Tempora mehr ; Vermischung der refl. &
nicht - refl. Pronomina; Transitivierungen
Deponentia mit aktiven Formen - Verben mit aktiven Deponentienformen
è nicht nur Annäherung an Volkssprache , sondern
"gelehrte`` Bildung nach antiken Erscheinungen
Wortbildung
Keine Hemmungen , Worte neu zu bilden è nach
antiken Ableitungs - & Kompositionsschemata
Aber auch unübliche Bildungen
Viele Wörter mit einem griechischen Bestandteil ; rein griech. Wörter
"lateinisiert"
Lutter , Christina u. Reimitz , Helmut , Römer und Barbaren, München 1997
Stotz , Peter, Die lateinische Sprache im Mittelalter, http://www.unizh.ch/mls/mittellatein.htm ,1998
Referat von Agnes Kollerbaur im LK Latein 12 / I
 |
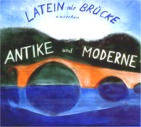 |
 |